BaCAI Lectures

In den BaCAI Lectures pr?sentieren exzellente Referentinnen und Referenten aus verschiedenen Themengebieten der Künstlichen Intelligenz ihre Forschung. Die Zielgruppe sind durch den Fokus auf Forschung und der Hauptsprache Englisch haupts?chlich Universit?tsangeh?rige, die Vorlesungen sind aber offen für alle Interessierten.
Veranstaltungsdetails (sofern nicht anders angegeben):
- Ort: WE5/00.022 (An der Weberei 5, Erba, Universit?t Bamberg)
- Start: 18 Uhr (c.t.)
- Dauer: ca. 1 Stunde plus Diskussion
- Sprache: Englisch
Anstehende Termine
Vergangene Termine der BaCAI Lectures
15.01.2026 Prof. Dr. Radu Timofte (Universit?t Würzburg) - Advances in AI-powered Photography and Imaging

Computergestützte Fotografie und Low-Level-Computer Vision sind Forschungsbereiche mit erheblichen Auswirkungen sowohl auf die Wissenschaft als auch auf die Industrie. Dieser Vortrag befasst sich mit den neuesten Fortschritten in der computergestützten Fotografie und Bildgebung. Wir werden neuronale Bildsignalprozessoren (ISPs), Fortschritte bei der Bildwiederherstellung und -verbesserung sowie Probleme bei der Bilddom?nenabbildung behandeln. Der Schwerpunkt liegt auf Herausforderungen, Erkenntnissen, der Qualit?t der Ergebnisse, der Komplexit?t und der Einsatzbereitschaft der L?sungen für reale Anwendungen.
?ber Prof. Dr. Timofte
Radu Timofte ist ordentlicher Professor (W3) und Leiter des Labors für Computer Vision (Lehrstuhl für Informatik IV) an der Universit?t Würzburg. Zuvor war er von 2013 bis 2016 als Postdoktorand und von 2016 bis 2022 als Dozent und Forschungsgruppenleiter an der ETH Zürich t?tig, wo er mit Prof. Luc Van Gool zusammenarbeitete. Er promovierte 2013 in Elektrotechnik an der KU Leuven in Belgien. Er ist (war) Mitherausgeber renommierter Fachzeitschriften: Elsevier CVIU, IEEE Trans. PAMI , Elsevier Neurocomputing und SIAM Journal on Imaging Sciences. Er ist regelm??ig als (Senior) Area Chair/SPC für führende Veranstaltungen im Bereich Bildverarbeitung und maschinelles Lernen t?tig: ICCV, ECCV, CVPR, IJCAI, NeurIPS, AAAI, ICLR, ICML. Radu Timofte ist Mitglied des Organisationsteams von ICIP'26 (Tampere) und ECCV'28 (Bukarest). Er und sein Team erhielten mehrere Auszeichnungen, darunter den Alexander-von-Humboldt-Professorenpreis 2022 und den Rum?nischen Akademiepreis 2021. Er ist Mitbegründer von Merantix, Mitorganisator der Veranstaltungen NTIRE, CLIC, AIM, MAI, AIS und PIRM, Mitglied von IEEE, CVF und ELLIS Fellow. Seine aktuellen Forschungsinteressen umfassen Augmented Perception, mobile KI, multimodales Lernen, Bild-/Videokompression, Restaurierung, Manipulation und Verbesserung.
Bis Januar 2026 hat er über 250 Artikel ver?ffentlicht, die über 74.500 Mal zitiert wurden, mit einem h-Index von 112.

Das Spektrum menschlicher Annotationen
Reflexionen aus dem letzen Jahrzehnt im Natural Language Processing
Menschliche Annotation ist inh?rent variabel und spiegelt eher Ambiguit?t, Subjektivit?t und vielf?ltige Interpretationen wider als blo?es Rauschen. Dieser Vortrag untersucht die Variation menschlicher Labels als Spektrum und beleuchtet ihre Implikationen für das Design von Datens?tzen, das Modelltraining und die Evaluation im NLP sowie für das Verst?ndnis, wie LLMs mit menschlichen Urteilen übereinstimmen. Ich diskutiere neuere Ans?tze, die diese Variation modellieren und nutzbar machen. Diese gehen über einzelne ?Gold“-Labels hinaus und führen zu Repr?sentationen, die den Reichtum menschlicher linguistischer Urteile besser erfassen.
?ber Prof. Dr. Barbara Plank:
Barbara Plank ist ordentliche Professorin und Lehrstuhlinhaberin für KI und Computerlinguistik an der LMU München, Leiterin des Munich AI and NLP (MaiNLP) Lab und Co-Direktorin des Center for Information and Language Processing (CIS). Sie ist au?erdem Gastprofessorin an der IT University of Copenhagen.

Das Tensor-Brain
Eine unifizierte Theorie der Wahrnehmung, des Ged?chtnisses und der semantischen Dekodierung
In unserem vorgeschlagenen Modell spiegelt der kognitive Gehirnzustand das dynamische Zusammenspiel zwischen sensorischen Eingaben und kognitiven Prozessen h?herer Ordnung wider. Er wird kontinuierlich durch subsymbolische (Bottom-up) Signale – die von Sinnesmodalit?ten, internen Verarbeitungsmodulen und Belohnungssystemen ausgehen – geformt und durch symbolische (Top-down) Einflüsse gesteuert, die Elemente wie Wiedererkennung, Ziele, Entscheidungen, zeitliche Marker, Pr?dikate und Handlungen kodieren.
Wir postulieren, dass die leitenden Prinzipien der Bottom-up- und Top-down-Interaktionen aus der mathematischen Struktur der Quantentheorie abgeleitet werden k?nnen. In diesem Rahmen wird der Zustand eines Systems nicht nur durch externe Eingaben beeinflusst, sondern auch durch generative Messungen, die von einem Agenten-Beobachter initiiert werden – ein Konzept, das wir als Messung im Heisenberg-Stil beschreiben. Der entsprechende probabilistische Prozess spiegelt die Bayes'sche Inferenz wider, weicht aber in wesentlichen Punkten davon ab: Wo traditionelle Bayes'sche Aktualisierungen Ann?herungen erfordern k?nnen (z. B. variationelle Methoden), bietet die Formulierung im Heisenberg-Stil eine handhabbare Alternative zur Zustandsaktualisierung unter Unsicherheit.
Bei der Bottom-up-Verarbeitung aktivieren sensorische Informationen die subsymbolische Repr?sentationsebene, die wiederum entsprechende symbolische Strukturen in der Indexebene aktiviert. Bei der Top-down-Verarbeitung aktivieren und modulieren symbolische Indizes den kognitiven Gehirnzustand, der durch Embodiment frühere sensorische und perzeptuelle Stadien beeinflussen kann. Dieser Mechanismus unterstützt das semantische Ged?chtnis, indem er abstraktes, symbolisches Wissen mit perzeptueller Erfahrung integriert, und dient als Grundlage für das episodische Ged?chtnis, indem er die Rekonstruktion vergangener perzeptueller, emotionaler, Belohnungs- und Handlungszust?nde erm?glicht.
?ber Prof. Dr. Volker Tresp:
Volker Tresp ist Professor an der Ludwig-Maximilians-Universit?t München (LMU). Er erhielt 1984 sein Diplom in Physik von der Universit?t G?ttingen sowie 1986 und 1989 seine Abschlüsse als M.Sc., M.Phil. und Ph.D. von der Yale University. W?hrend seiner Promotion arbeitete er in der Image Processing and Analysis Group (IPAG) in Yale. 1990 kam er zu Siemens, wo er verschiedene Forschungsteams im Bereich des maschinellen Lernens leitete.1997 wurde er für seine Innovationen in der Forschung zu neuronalen Netzen zum Siemens Erfinder des Jahres ernannt und 2018 wurde er der erste Siemens Distinguished Research Scientist. Er revolutionierte die Stahlverarbeitung durch die Entwicklung eines neuartigen Ansatzes mit Bayes'schen neuronalen Netzen, der auf geschickte Weise reale Daten mit simulierten Daten aus einer früheren L?sung integrierte. 1994 war er Gastwissenschaftler am Massachusetts Institute of Technology im Center for Biological and Computational Learning und arbeitete dort mit den Teams von Tomaso Poggio und Michael I. Jordan zusammen. Er war Mitherausgeber von Advances in Neural Information Processing Systems 13. 2011 wurde er zum Professor für Informatik an der LMU ernannt, wo er einen Kurs über maschinelles Lernen h?lt und ein zweites Forschungsteam leitet.Er ist bekannt für seine Arbeit zum Bayes'schen maschinellen Lernen, insbesondere die Bayesian Committee Machine und seine Arbeit zum hierarchischen Lernen mit Gau?-Prozessen. Das IHRM, das SRM, SUNS und RESCAL sind Meilensteine im Repr?sentationslernen für multi-relationale Graphen. Sein Team hat Pionierarbeit im Bereich des maschinellen Lernens mit Wissensgraphen, temporalen Wissensgraphen und der Analyse von Szenengraphen geleistet. Die Arbeit am Tensor Brain spiegelt sein Interesse an mathematischen Modellen für Kognition und Neurowissenschaften wider. Im Jahr 2020 wurde er Fellow des European Laboratory for Learning and Intelligent Systems (ELLIS). Als Co-Direktor (zusammen mit Kristian Kersting und Paolo Frasconi) leitet er das ELLIS-Programm "Semantic, Symbolic and Interpretable Machine Learning".

Was gro?e Sprachmodelle noch immer nicht verstehen
Vertrauen, Mehrdeutigkeit und die Grenzen der Skalierung
Trotz ihrer beeindruckenden F?higkeiten haben gro?e Sprachmodelle (LLMs) immer noch mit grundlegenden Herausforderungen zu k?mpfen, die das Vertrauen untergraben: Mehrdeutigkeit, Inkonsistenz und die Unf?higkeit, zwischen gültiger Variation und Fehler zu unterscheiden. In diesem Vortrag werde ich einen ?berblick über die derzeitigen Grenzen von LLMs bei der Verarbeitung natürlicher Sprache geben und aufzeigen, wie das vorherrschende Paradigma oft den Reichtum von Unstimmigkeiten und die Komplexit?t der sprachlichen Bedeutung übersieht. Als Weg in die Zukunft schlage ich vor, Variation in drei Kernbereichen zuzulassen: die Eingaben in unsere Modelle, die Ergebnisse, die sie produzieren, und die Forschungspraktiken, die wir anwenden. Indem wir die Unsicherheit, die sich aus der Variation in der Sprache ergibt, anerkennen und modellieren — anstatt sie weg zu abstrahieren — k?nnen wir uns in Richtung einer innovativeren, umfassenderen und vertrauenswürdigeren natürlichen Sprachverarbeitung bewegen.
Despite their impressive capabilities, large language models (LLMs) still struggle with fundamental challenges that undermine trust: ambiguity, inconsistency, and the inability to distinguish between valid variation and error. In this talk, I will provide an overview of current limitations of LLMs in processing natural language and highlight how the prevailing paradigm often overlooks the richness of disagreement and the complexities of linguistic meaning. As a path forward, I propose to embrace variation in three core areas: the inputs to our models, the outputs they produce, and the research practices we adopt. By acknowledging and modeling uncertainty that arises from variation in language — rather than abstracting it away — we can move toward a more innovative, inclusive, and trustworthy NLP.
?ber Prof. Dr. Barbara Plank:
Barbara Plank ist ordentliche Professorin und Lehrstuhlinhaberin für KI und Computerlinguistik an der LMU München, Leiterin des Munich AI and NLP (MaiNLP) Lab und Co-Direktorin des Center for Information and Language Processing (CIS). Sie ist au?erdem Gastprofessorin an der IT University of Copenhagen.
UPDATE: Der Vortrag von Prof. Barbara Plank muss leider entfallen und wird im Wintersemester nachgeholt.

Verantwortungsvolle KI-Entwicklung sicherstellen
Viele KI-Technologien werden inzwischen in den Alltag integriert. Doch wie k?nnen wir sicherstellen, dass KI ?verantwortungsvoll“ ist? In diesem Vortrag werde ich einen ?berblick über die aktuellen Bemühungen zur Entwicklung verantwortungsvoller KI geben, wobei ich mich auf Erkl?rungen, Fairness und Auditing konzentrieren werde, und Vorschl?ge unterbreiten, wie wir die Ans?tze in diesem Bereich verbessern k?nnen.
?ber Prof. Dr. Simone Stumpf:
Simone Stumpf ist Professorin für Verantwortungsvolle und Interaktive KI an der Universit?t Glasgow, UK. Ihr langj?hriger Forschungsschwerpunkt sind Nutzerinteraktionen mit maschinellen Lernsystemen. Ihre Forschung umfasst Selbstmanagementsysteme für Menschen mit Langzeiterkrankungen, die Entwicklung von lernf?higen KI-Systemen Menschen ohne technischen Hintergrund die Untersuchung von verantwortungsvoller KI-Entwicklung, einschlie?lich KI-Fairness. Ihre Arbeit hat dazu beigetragen, den Bereich der erkl?rbaren KI (XAI) durch den Explanatory Debugging-Ansatz für interaktives maschinelles Lernen mitzugestalten, Gestaltungsprinzipien für eine bessere Mensch-Computer-Interaktion bereitzustellen und die Auswirkungen einer gr??eren Transparenz zu untersuchen. Das Hauptziel ihrer Arbeit ist es, allen Nutzern zu erm?glichen, KI-Systeme effektiv zu nutzen.

Künstliche Intelligenz im Process Mining: Datenqualit?tsmanagement und automatisierte Prozessverbesserung im digitalen Zeitalter
In diesem Vortrag werden innovative Ans?tze zur Optimierung von Gesch?ftsprozessen durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) im Process Mining vorgestellt. Im Mittelpunkt steht dabei, wie KI-Technologien dazu beitragen, Gesch?ftsprozesse nachhaltig zu verbessern. Anhand aktueller Forschungsvorhaben am Center for Process Intelligence des Fraunhofer FIT und der Universit?t Bayreuth werden einschl?gige Forschungsthemen und praktische Beispiele pr?sentiert, die den Mehrwert datenbasierter Analysen im Prozessmanagement verdeutlichen. Neben einem ?berblick neuester Forschungsarbeiten in diesem Themenfeld geben wir einen Einblick in zwei konkrete Forschungsprojekte zur Qualit?tsverbesserung von Prozessdaten sowie zur automatisierten Prozessverbesserung – jeweils mittels KI. Der Vortrag liefert Impulse für die Gestaltung digitaler Transformationsprozesse und richtet sich an G?ste aus Wissenschaft und Praxis.
?ber Prof. Dr. Maximilian R?glinger:
Maximilian R?glinger ist Inhaber des Lehrstuhls für Wirtschaftsinformatik und Wertorientiertes Prozessmanagement an der Universit?t Bayreuth sowie Adjunct Professor an der School of Management der Queensland University of Technology. Zudem ist er Gesch?ftsführender Direktor des FIM Forschungsinstitut für Informationsmanagement und stellvertretender Institutsleiter des Fraunhofer FIT mit leitender Rolle am Institutsteil Wirtschaftsinformatik des Fraunhofer FIT. Herr R?glinger ist darüber hinaus Mitgründer der Digitalen Innovationswerkstatt, der Digital Leadership Academy und des Fraunhofer Center for Process Intelligence. Er ist Moderator des Masterstudiengangs Digitalisierung & Entrepreneurship und Ko-Leiter des Studiengangs Finance & Information Management in Kooperation mit der TU München.

Multi-Agenten-Pfadplanung auf gerichteten Graphen
Multi-Agent-Pfadplanung (MAPF) ist das Problem der Entscheidung über die Existenz oder der Generierung eines kollisionsfreien Bewegungsplans für eine Gruppe von Agenten, die sich auf einem Graphen bewegen. Aufgrund seiner Relevanz für Themen wie u.a. Intralogistik, Luftverkehrskoordination und Videospiele hat dieses Problem in letzter Zeit viel Interesse gefunden.
Nach einem ?berblick über theoretische Ergebnisse und algorithmische Ans?tze, die verwendet werden um das Problem zu l?sen, werde ich mich auf die Variante konzentrieren, bei der der Graph gerichtet ist. W?hrend die nicht-optimierende Variante der Multi-Agenten-Pfadplanung auf ungerichteten Graphen seit fast vierzig Jahren als Polynomialzeit-Problem bekannt ist, war ein ?hnliches Ergebnis für gerichtete Graphen lange unbekannt. Erst 2023 wurde gezeigt, dass dieses Problem NP-vollst?ndig ist. Für stark zusammenh?ngende gerichtete Graphen ist das Problem jedoch polynomiell. Und beide Ergebnisse gelten auch dann, wenn man synchrone Rotationen auf voll besetzten Zyklen zul?sst.
?ber Prof. Dr. Bernhard Nebel
Bernhard Nebel studierte an der Universit?t Hamburg und schloss sein Studium als Dipl.-Inform. 1980 ab. 1989 promovierte er zum Dr. rer. nat. an der Universit?t des Saarlandes. Zwischen 1982 und 1993 arbeitete er in verschiedenen KI-Projekten an der Universit?t Hamburg, der TU Berlin, ISI/USC, IBM Deutschland, und am Deutschen Forschungszentrum für KI (DFKI). Von 1993 bis 1996 war er C3-Professor an der Universit?t Ulm. Von 1996 bis 2022 war er C4/W3-Professor an der Albert-Ludwigs-Universit?t Freiburg und leitet die Arbeitsgruppe Grundlagen der Künstlichen Intelligenz. Seit April 2022 ist er im Ruhestand.
Bernhard Nebel war Mitglied des SFB TR/14 Automatic Verification and Analysis of Complex Systems (AVACS) (2004-2015), und war Sprecher der Freiburger Gruppe im SFB TR/8 Spatial Cognition (2003-2014).
Neben anderen T?tigkeiten war er Ko-Programmkomiteevorsitzender der dritten International Conference on Principles of Knowledge Representation and Reasoning (KR'92), Ko-Programmkomiteevorsitzender der 18. German Annual Conference on AI (KI'94), Organisator der 21. German Annual Conference on Artificial Intelligence (KI'97), Programmkomiteevorsitzender der 17. International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI'01) und Ko-Konferenzorganisator der 18. International Conference on Automated Planning and Scheduling (ICAPS'08). 2001 wurde er zum EurAI Fellow ernannt. Seit 2009 ist er gew?hltes Mitglied der deutschen Akademie der Naturforscher Leopoldina. 2010 wurde er zum AAAI Fellow ernannt, und seit 2011 ist er Mitglied der Academia Europaea. 2019 wurde er von der GI als einer der 10 pr?genden K?pfe der deutschen KI-Geschichte ausgezeichnet und seit 2022 ist er ein ACM Fellow. Au?erdem wurde er 2022 mit dem Donald E. Walker Distinguished Service Award ausgezeichnet.
Bernhard Nebel ist (Ko-)Autor und (Ko-)Editor von 14 Büchern und Konferenz-Proceeding-B?nden und (Ko-)Autor von mehr als 200 begutachteten Artikeln in wissenschaftlichen Zeitschriften, Büchern und Konferenz-Proceedings.
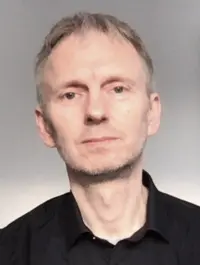
Unsicherheitsquantifizierung beim Maschinellen Lernen: Von Aleatorisch zum Epistemisch
Aufgrund der stetig wachsenden Bedeutung des Maschinellen Lernens (ML) für praktische Anwendungen, von denen viele mit Sicherheitsanforderungen einhergehen, hat der Begriff der Unsicherheit in der Forschung zu ML in der jüngsten Vergangenheit zunehmend an Bedeutung gewonnen. In diesem Vortrag werden Fragen zur Darstellung und zum ad?quaten Umgang mit (pr?diktiver) Unsicherheit im (überwachten) ML behandelt. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf der Unterscheidung zwischen zwei wichtigen Arten von Unsicherheit, die oft als aleatorisch und epistemisch bezeichnet werden, und auf der Frage, wie diese Unsicherheiten in Form von geeigneten numerischen Ma?en quantifiziert werden k?nnen. Grob gesagt ist die aleatorische Unsicherheit auf die Zuf?lligkeit des Datenerzeugungsprozesses zurückzuführen, w?hrend die epistemische Unsicherheit durch die Unkenntnis des Lernenden über das wahre zugrunde liegende Modell verursacht wird.
Zu Prof. Dr. Eyke Hüllermeier
Eyke Hüllermeier ist ordentlicher Professor am Institut für Informatik der LMU München, wo er den Lehrstuhl für Künstliche Intelligenz und Maschinelles Lernen innehat. Er studierte Mathematik und Wirtschaftsinformatik, promovierte 1997 in Informatik an der Universit?t Paderborn und habilitierte sich 2002. Bevor er an die LMU kam, hatte er Professuren an mehreren anderen deutschen Universit?ten (Dortmund, Magdeburg, Marburg, Paderborn) inne und verbrachte zwei Jahre als Marie-Curie-Stipendiat am IRIT in Toulouse (Frankreich).
Seine Forschungsinteressen konzentrieren sich auf Methoden und theoretische Grundlagen der Künstlichen Intelligenz, mit einem besonderen Schwerpunkt auf Maschinellem Lernen, Pr?ferenzmodellierung und Argumentation unter Unsicherheit. Er hat mehr als 400 Artikel zu verwandten Themen in hochrangigen Fachzeitschriften und auf gro?en internationalen Konferenzen ver?ffentlicht, und mehrere seiner Beitr?ge wurden mit wissenschaftlichen Preisen ausgezeichnet. Professor Hüllermeier ist Hauptherausgeber von "Data Mining and Knowledge Discovery", einer führenden Fachzeitschrift im Bereich der Künstlichen Intelligenz, und geh?rt den Redaktionsausschüssen mehrerer anderer Fachzeitschriften für Künstliche Intelligenz und Maschinelles Lernen an. Er ist derzeit Pr?sident der European Association for Data Science (EuADS), Mitglied des Strategy Board des Munich Center for Machine Learning (MCML) und Mitglied des Steering Committee der Konrad Zuse School of Excellence in Reliable AI (relAI).

A cautionary tale of health AI development and deployment
In diesem Vortrag geht es um die verschiedenen Herausforderungen, die sich bei der Entwicklung und dem Einsatz von KI-Algorithmen in gro?em Ma?stab in verschiedenen Regionen ergeben. Insbesondere die generative KI ist vielversprechend, um Zugangsbarrieren abzubauen und die Qualit?t der Gesundheitsversorgung auf der ganzen Welt zu verbessern. Es ist jedoch wichtiger denn je, sicherzustellen, dass diese Algorithmen ordnungsgem?? validiert und getestet werden und genügend Investitionen get?tigt werden, um zu gew?hrleisten, dass ihre Vorteile gleichm??ig über verschiedene Bev?lkerungsgruppen verteilt werden.
Zu Ira Ktena, PhD
Ira Ktena ist Wissenschaftliche Mitarbeiterin bei Google DeepMind und arbeitet an der Forschung zum sicheren und zuverl?ssigen Maschinellen Lernen (ML). Zuvor war Sie leitende Forscherin für ML im Cortex Applied Research Team bei Twitter UK, wo sie sich auf Echtzeit-Personalisierung konzentrierte, w?hrend sie an der Schnittstelle von Empfehlungssystemen und algorithmischer Transparenz forschte. ?ber deren Forschungen zur algorithmischen Verst?rkung politischer Inhalte auf Twitter berichteten unter anderem der Economist und die BBC.

Warum müssen sich LLMs Sorgen machen?
Vorlesungssprache: Englisch
Die Achillesferse der Forschung im Bereich der natürlichen Sprachverarbeitung war lange Zeit Rauschen in Datens?tzen, insbesondere ungenaues Labelling. Obwohl es einen Paradigmenwechsel von kleinen Expertenmodellen, die auf gelabelten Datens?tzen trainiert werden, zu gro?en Sprachmodellen (LLMs) gegeben hat, die auf weitgehend unmarkierten Daten trainiert werden und eine Vielzahl von Aufgaben l?sen k?nnen, bleiben die Probleme der ?bersch?tzung und Verzerrungen bestehen. In diesem Vortrag werde ich einige Methoden zur Unsicherheitsabsch?tzung in aufgabenorientierten Dialogen vorstellen und diese zur automatischen Korrektur der Beschriftungen in den zugrunde liegenden Datens?tzen nutzen. Ich werde Hypothesen aufstellen, wie dies die Tür zur L?sung verwandter Probleme in LLMs ?ffnen k?nnte.
?ber Prof. Dr. Milica Ga?i?:
Milica Ga?i? ist Professorin der Gruppe Dialogsystems and Machine Learning an der Heinrich-Heine-Universit?t Düsseldorf. Ihre Forschung konzentriert sich auf grundlegende Fragen der Dialogmodellierung zwischen Mensch und Computer und liegt im Schnittpunkt von natürlicher Sprachverarbeitung und maschinellem Lernen. Vor ihrer jetzigen Position war sie Dozentin für Spoken Dialogue Systems am Department of Engineering der Universit?t Cambridge, wo sie die Dialogue Systems Group leitete. Zuvor war sie Research Associate und Senior Research Associate in der gleichen Gruppe und Research Fellow am Murray Edwards College. Sie schloss ihre Promotion unter der Leitung von Professor Steve Young ab. Das Thema ihrer Dissertation war Statistical Dialogue Modelling, für die sie einen EPSRC PhD Plus Award erhielt. Sie hat einen MPhil-Abschluss in Computer Speech, Text and Internet Technology von der University of Cambridge und ein Diplom (BSc. equivalent) in Mathematik und Informatik von der Universit?t Belgrad. Sie ist Mitglied der ACL, Mitglied von ELLIS und Seniormitglied von IEEE sowie Mitglied des internationalen wissenschaftlichen Beirats des DFKI.

Probabilistische und Deep Learning-Techniken für Roboternavigation und automatisiertes Fahren
Die F?higkeit, Umgebungen robust wahrzunehmen und Aktionen auszuführen ist das ultimative Ziel bei der Entwicklung von autonomen Robotern und automatisiertem Fahren. Die gr??te Herausforderung besteht darin, dass keine Sensoren oder Aktoren perfekt sind. Roboter und Autos müssen daher in der Lage sein, mit der daraus resultierenden Unsicherheit angemessen umzugehen. In diesem Vortrag werde ich den probabilistischen Ansatz in der Robotik vorstellen, der eine strenge statistische Methodik im Umgang mit Zustandssch?tzungsproblemen bietet. Darüber hinaus werde ich er?rtern, wie dieser Ansatz mit modernster Technologie des Maschinellen Lernens kombiniert werden kann, um mit komplexen und sich ver?ndernden realen Umgebungen umzugehen.
Zu Prof. Dr. Wolfram Burgard
Prof. Dr. Wolfram Burgard ist ein angesehener Professor für Robotik und Künstliche Intelligenz an der Technischen Universit?t Nürnberg, wo er auch den Gründungslehrstuhl der Fakult?t für Ingenieurwissenschaften innehat. Zuvor war er von 1999 bis 2021 Professor für Informatik an der Albert-Ludwigs-Universit?t Freiburg, wo er das renommierte Forschungslabor für Autonome Intelligente Systeme aufbaute. Seine Fachgebiete sind Künstliche Intelligenz und mobile Roboter, wobei er sich auf die Entwicklung von robusten und adaptiven Verfahren zur Zustandssch?tzung und -steuerung konzentriert. Zu Wolfram Burgards Erfolgen geh?rt der Einsatz des ersten interaktiven mobilen Führungsroboters Rhino im Deutschen Museum Bonn im Jahr 1997. Au?erdem entwickelten er und sein Team 2008 einen bahnbrechenden Ansatz, der es einem Auto erm?glichte, autonom durch ein komplexes Parkhaus zu navigieren und selbst einzuparken. Im Jahr 2012 entwickelten er und sein Team den Roboter Obelix, der sich autonom wie ein Fu?g?nger vom Campus der Technischen Fakult?t in die Freiburger Innenstadt bewegte. Wolfram Burgard hat über 350 Beitr?ge und Artikel auf Konferenzen und in Fachzeitschriften für Robotik und Künstliche Intelligenz ver?ffentlicht. Au?erdem ist er Mitautor der beiden Bücher "Principles of Robot Motion - Theory, Algorithms, and Implementations" und "Probabilistic Robotics". Im Jahr 2009 wurde er mit dem Gottfried Wilhelm Leibniz-Preis ausgezeichnet, dem renommiertesten Forschungspreis in Deutschland. Er ist Mitglied der Heidelberger Akademie der Wissenschaften und der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina.

Besonderheiten und Herausforderungen für Maschinelles Lernen in der intraoperativen Bildgebung
Auf dem Weg zu Pr?zision und Intelligenz in dynamischen Umgebungen mit hoher Intensit?t
Vortrag auf Englisch
In den letzten zehn Jahren haben die rasanten Fortschritte im Bereich des Maschinellen Lernens (ML) verschiedene Bereiche revolutioniert und unser Leben erheblich beeinflusst. In diesem Vortrag werden wir in den Bereich der medizinischen Anwendungen eintauchen und die Herausforderungen und M?glichkeiten untersuchen, die mit der Integration dieser Spitzentechnologien in computergestützte Interventionen verbunden sind. Unser Hauptaugenmerk liegt dabei auf der F?rderung der Akzeptanz und des Vertrauens in ML und Robotikl?sungen im medizinischen Bereich, was oft den Weg über Intelligence Amplification (IA, "Intelligenz-Verst?rkung") erfordert. Mit Augmented Reality (AR) k?nnen wir IA nutzen, um die menschliche Intelligenz und Expertise zu erweitern, was letztlich den Weg für die nahtlose Integration von Künstlicher Intelligenz (KI) und Robotik in klinischen L?sungen ebnet.
Ausgehend von einigen bahnbrechenden Forschungsarbeiten, die am Lehrstuhl für Computer Aided Medical Procedures (computergestützte medizinische Verfahren) an der TU München und der Johns Hopkins University durchgeführt wurden, werde ich eine Reihe neuartiger Techniken vorstellen, die für die besonderen Anforderungen medizinischer Anwendungen entwickelt wurden. Insbesondere werden wir ihre praktischen Implementierungen in verschiedenen Bereichen untersuchen, darunter die robotergestützte Ultraschallbildgebung, die multimodale Datenanalyse und semantische Szenegraphen für die ganzheitliche Modellierung des chirurgischen Bereichs. Darüber hinaus werde ich überzeugende Beispiele dafür vorstellen, wie AR-L?sungen als Katalysator für die Einführung von KI in der computergestützten Chirurgie dienen k?nnen. Indem wir uns die Macht von IA zunutze machen, k?nnen wir das volle Potenzial von KI-Technologien freisetzen, die Akzeptanz f?rdern und die Zukunft computergestützter Eingriffe vorantreiben. Begleiten Sie mich auf dieser aufschlussreichen Reise durch die komplizierten ?berschneidungen von Maschinellem Lernen, medizinischem Fortschritt und dem Weg von der "Intelligenz-Verst?rkung" zur Künstlichen Intelligenz im Gesundheitswesen.
Zu Prof. Dr. Nassir Navab
Prof. Dr. Nassir Navab ist ordentlicher Professor und Direktor des Lehrstuhls für Computer Aided Medical Procedures (CAMP) an der Technischen Universit?t München (TUM) und au?erplanm??iger Professor an der Johns Hopkins Universit?t. Er ist auch Leiter der zweimal j?hrlich stattfindenden Medical Augmented Reality Vorlesungsreihe an der Balgrist Klinik in Zürich. Er ist Mitglied der Academia Europaea und erhielt 2021 den prestigetr?chtigen MICCAI Enduring Impact Award und 2015 den IEEE ISMAR 10 Years Lasting Impact Award. Im Jahr 2001, als er als angesehener technischer Mitarbeiter bei Siemens Corporate Research (SCR) in Princeton t?tig war, erhielt er die renommierte Siemens Inventor of the Year Auszeichnung für seine Arbeit auf dem Gebiet der Interventionellen Bildgebung. Au?erdem erhielt er den SMIT Technology Innovation Award im Jahr 2010 und wird im Jahr 2024 Medical AR Pioneer in der AWE XR Hall of Fame. Seine Studierenden haben viele Auszeichnungen für ihre Arbeiten erhalten, darunter 15 Auszeichnungen bei den renommierten MICCAI-Veranstaltungen, 5 bei IPCAI, 2 bei IPMI und 4 bei IEEE ISMAR. Er ist Fellow der MICCAI Society und war im Vorstand von 2007 bis 2012 und von 2014 bis 2017. Er ist au?erdem ein IEEE Fellow und Fellow der Asia-Pacific Artificial Intelligence Association (AAIA) und einer der Gründer des IEEE Symposium on Mixed and Augmented Reality (ISMAR) und ist seit 2001 Mitglied des Lenkungsausschusses seit 2001. Er ist ein Area Chair für ECCV 2024. Er ist Autor von Hunderten von wissenschaftlichen Arbeiten und über 100 erteilten US- und internationalen Patenten. Im April 2024 wurden seine Arbeiten über 76.600 Mal zitiert und haben einen h-Index von 117.

Wie man Künstliche Intelligenz menschlicher machen kann
Die Beziehung zwischen Menschen und Maschine, insbesondere im Kontext Künstlicher Intelligenz (KI), ist von Hoffnungen, Bedenken und moralischen Fragen gepr?gt. Auf der einen Seite bieten Fortschritte in der KI gro?e Hoffnungen: Sie verspricht L?sungen für komplexe Probleme, verbesserte Gesundheitsversorgung, effizientere Arbeitsabl?ufe und vieles mehr. Doch gleichzeitig gibt es berechtigte Bedenken hinsichtlich der Kontrolle über diese Technologie, ihrer potenziellen Auswirkungen auf Arbeitspl?tze und Gesellschaft, sowie ethischer Fragen im Zusammenhang mit Diskriminierung und dem Verlust menschlicher Autonomie. Der Vortrag wird das komplexe Spannungsfeld zwischen Innovation und moralischer Verantwortung in KI Forschung beleuchten und illustrieren.
Zu Prof. Dr. Kristian Kersting
Prof. Dr. Kristian Kersting ist Kodirektor des Hessischen Zentrums für Künstliche Intelligenz (hessian.AI) und leitet das Fachgebiet KI und Maschinelles Lernen an der TU Darmstadt. Seine Forschung umfasst Deep Probabilistic Programming and Learning sowie Explainable AI. Er ist Fellow der Association for the Advancement of AI (AAAI), der European Association for AI (EurAI) und des European Lab for Learning and Intelligent Systems (ELLIS), Buchautor ("Wie Maschinen lernen") und Tr?ger des "Deutschen KI-Preises 2019”. Er schreibt eine monatliche KI-Kolumne in der Welt.
